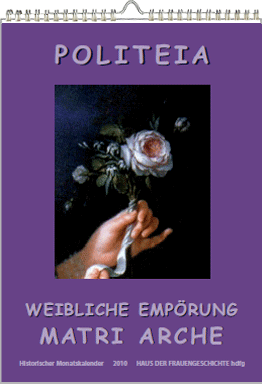|
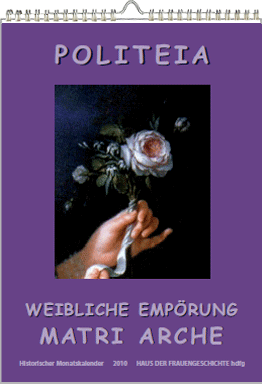
Herausgeberin:
Marianne Hochgeschurz
Blick in den
Kalender
(PDF-Info-Blatt 139 KB) |
 |
Liebe
Kalender-Geschichte(n)-Leserinnen und -Leser! |
 |
Entscheiden wir uns für den Weg, den wir
einschlagen wollen, und versuchen wir, ihn mit Blumen zu säumen,
schreibt die französische Philosophin Marquise Emile de Châtelet um
1750 in ihrer Schrift Discours sur le bonheur / Über das
Glück. Im vierten POLITEIA-MATRI-Kalender werden Frauen gewürdigt,
die sich in diesem Sinne für ihren Weg entschieden haben.
Aus der
großen Zahl derer, die - allen männlichen Behinderungen zum Trotz -
ihre eigenen Wege gingen, werden 12 Frauen und ihre historischen Schwestern
gewürdigt: als Humanistinnen, Aufklärerinnen, Reformerinnen und
Revolutionärinnen. Ob Schriftstellerin, Wissenschaftlerin oder
Künstlerin, ob Aristokratin, Bürgerin oder Marktfrau, ob Mutter,
Gottesbraut, Ehefrau oder Liebhaberin, bei ihnen allen finden wir diese
weibliche Kraft, die als neuzeitliches matriarchales Muster die Spirale der
Zeit weiterbewegt hat. Mit ihrer Empörung gegen Unrecht und Unfreiheit
brachten Frauen die bestehenden Gewaltstrukturen ins Wanken, während sie
zugleich nach neuen Wegen suchten, die Beziehungen zwischen Frauen und
Männern in ein liebevolles Gleichgewicht zu bringen.
Die so genannte
Neuzeit, von etwa der Mitte des 16. bis ins beginnende 19. Jahrhundert, war
geprägt von auffallender Unruhe in den Geschlechterbeziehungen. Nach dem
Scheitern der Hexenprozesse suchten Männer das weibliche Begehren auf
"moderne" Weise zu beherrschen. Wortgewaltig karikierten sie die Frauen als
sittenlos und bildungsunfähig, um so ihren Ausschluss aus den
männlich definierten öffentlichen Räumen zu begründen.
Kriege und ökonomische Krisen waren die Folgen. Den Frauen, die eine
Versorgungsehe ablehnten, wurde die eigenständige Existenzsicherung
erschwert. - In den Querelle des Femmes entlarvten die Frauen diese
misogynen Strategien der Männer. Sie empörten sich, verweigerten ihr
Mitmachen in männlichen Konzepten und vergewisserten sich ihrer eigenen
weiblichen Stärken. - Frauen nahmen auch die Rose selbst in die
Hand!
Diesen historischen Frauen widme ich die Rose, die die
französische Malerin Elisabeth Vigée-Lebrun im Jahr 1783 malte und
überreiche sie im Titelbild auch Ihnen, mit guten Wünschen für
ein "blumengesäumtes" Jahr 2010!
Marianne Hochgeschurz
Titelbild:
Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie Antionette à la rose, 1783,
Ausschnitt, National Gallery of Art, Washington, aus: SPIRALE DER ZEIT / SPIRAL
OF TIME, Heft 4/2009, S. 37. |
|
 |